Die Psyche im Corona-Stress
Jedes Jahr ermittelt die Gesellschaft für österreichisches Deutsch die (Un-)wörter des Jahres. Wie auch in allen anderen Bereichen unseres Lebens stand auch hier die COVID-19 Pandemie im Mittelpunkt.
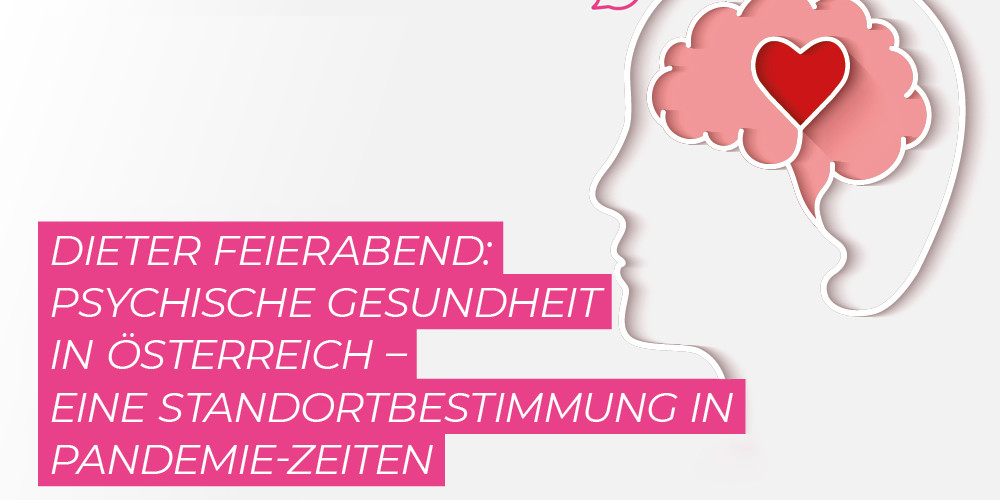
Zum Wort des Jahres wurde Babyelefant gekürt, als Unwort wurde Coronaparty gewählt. Abstand ist gut, Nähe nicht gewünscht – 2020 haben wir mit "social distancing" leben gelernt.
Klar ist, dass wir unsere Kontakte reduzieren müssen, gleichzeitig hat „social distance“ leider oftmals im wahrsten Sinne des Wortes stattgefunden. Gemeinsam mit gesundheitlichen, familiären und ökonomischen Sorgen oder erhöhtem Stress, ergibt sich ein Umfeld, das für unser Wohlbefinden, also für die psychische Gesundheit, eine enorme Herausforderung darstellt. In den letzten Monaten haben wir viel über Gesundheitsthemen diskutiert, leider ist jedoch die Diskussion um unsere Psyche in Krisenzeiten nur ein Randthema. Dabei zeigen aktuelle Studien, dass wir hier als Gesellschaft vor enormen Herausforderungen stehen.
Vor kurzem wurde durch eine Parlamentarische Anfrage bekannt, dass Forscher_innen der Donau-Universität Krems zu der Erkenntnis gekommen sind, dass Angstsymptome, Schlafstörungen und Depressionen während der Pandemie signifikant angestiegen sind. Zu ähnlichen Ergebnissen kam eine Befragung der Psychosozialen Dienste in Wien, ebenso Studien der Universität Wien und der Sigmund Freud Universität.
Dies ist jedoch kein österreichisches Spezifikum. OECD Daten zeigen, dass in allen Ländern mit aktuellen Daten ein Anstieg zu beobachten ist. Insbesondere Menschen mit niedrigeren Einkommen, Junge, und sogenannte "front-line" Arbeiter, wie Gesundheitspersonal, besonders sind betroffen. Dies gilt auch für an Corona Erkrankte und Personen, die schon vor der Pandemie keine gute psychische Gesundheit hatten. Auch wir im NEOS Lab haben in unserer Umfrage mit SORA im Rahmen des Freiheitsindex festgestellt, dass ein erheblicher Teil der Bevölkerung von einer verschlechternden psychischen Gesundheit berichtet. Unser Gesundheitssystem ist darauf jedoch nur bedingt darauf vorbereitet und steht vor drei großen Hürden, die oftmals selbstgemacht sind:
Erstens ist das Thema psychische Gesundheit immer noch nicht in unserem gesellschaftlichen Alltag angekommen und geht in Diskussionen unter. Dies liegt einerseits, trotz aller Fortschritte, immer noch am Wissensstand über psychische Gesundheit und damit einhergehend Stigmata und Vorurteile. Gleichzeitig werden Themen des psychischen Wohlbefindens oftmals schnell als persönliche Befindlichkeiten abgetan.
Als während des ersten Lockdowns die Diskussion um die Öffnung der Bundesgärten geführt wurde, wurde vor allem gefragt, ob es denn notwendig sei, jetzt in Parks zu gehen. Dabei empfehlen Gesundheitsbehörden wie die WHO oder CDC Spaziergänge an der frischen Luft, um das eigene Wohlbefinden zu stärken. Auch Diskussionen um junge Erwachsene wird so geführt. Sie sollen weniger Freunde treffen, „nicht so egoistisch“ sein, zum Schutz von Risikogruppen. Dass gerade über eine Gruppe, die eine besonders starke Verschlechterung der psychischen Gesundheit angegeben hat und überdurchschnittlich von Einkommenseinbußen getroffen ist, gesprochen wird wie über ungezogene Kleinkinder, wird der Debatte nicht gerecht.
Zweitens haben wir Aufholbedarf bei der psychischen Gesundheitsinfrastruktur. Das geht über das Grundproblem des fehlenden Kassenvertrag für Psychotherapie hinaus. Wer in der Stadt Basel, 200.000 Einwohner, medizinisches Fachpersonal sucht, findet aktuell 211 niedergelassene Psychiater und 93 Psychologen die, je nachdem welchen Kassenvertrag man gewählt hat, ein entsprechendes Leistungsportfolio anbieten.
Niederösterreich hat 1.684.287 Einwohner und hatte, laut regionalem Strukturplan Gesundheit 22,3 Planstellen für niedergelassene Fachärzt_innen mit Kassenvertrag. Bis 2025 sollen diese auf 27,9 Planstellen angehoben werden. Insbesondere in ländlichen Regionen Österreichs ist fraglich, wie gut die psychische Gesundheitsversorgung aktuell gewährleistet ist. Hier kann die im Sommer erfolgte Aufstockung der Psychotherapiekontingente und der von der Bundesregierung ausgerufene „Pakt gegen Einsamkeit“ nur der Startschuss sein.
Drittens haben wir viel zu wenig öffentlich zugängliche Daten. Zwar weist die OECD darauf hin, dass in allen Mitgliedsstaaten zu wenig Evidenz erhoben wird, aber in Österreich sehen wir viele selbstverschuldete Lücken. Beispielsweise hat sich die Bundesregierung Zielvorgaben gegeben, um allen Menschen in Österreich ein langes und gesundes Leben zu gewährleisten, auch für die psychische Gesundheit. Um Ziele erreichen zu können, benötigt es Indikatoren, die diese erfassen. In einem 2017 von der Gesundheit Österreich veröffentlichten Bericht wird jedoch klar, dass wir für einige der Wirkungsziele keine passenden Indikatoren haben. Mindestens genauso schwerwiegend ist, dass für alle Indikatoren geeignete Zielvorgaben fehlen.
Dies ist nur eines von vielen Fallbeispielen. Regelmäßige Studien zur Erhebung des Wohlbefindens oder der Prävalenz von psychischen Erkrankungen, die Übersterblichkeit von Menschen mit psychischen Erkrankungen oder die Wartezeiten auf Therapieplätze sind nur einige der Bereiche in denen es keine öffentlichen Daten gibt.
Deshalb ist es notwendig, dass die Bundesregierung einen Schwerpunkt auf psychische Gesundheit legt. Wir müssen unsere Gesundheitsinfrastruktur ausbauen, mehr Daten erheben, insbesondere eine aktuelle Prävalenzerhebung für psychische Erkrankungen und eine darauf aufbauende Analyse des gedeckten Bedarfs und Maßnahmen im Lebensumfeld forcieren. Für pandemiebedingte politische Vorhaben gilt, dass die psychische Gesundheit bei Maßnahmen und Kommunikation verstärkt mitgedacht werden müssen. Klarheit und Empathie sollten im Vordergrund stehen statt Hü-Hott und das Arbeiten mit Angst.
Die Pandemie ist noch nicht vorbei, weiterhin gilt das wir physische Kontakte einschränken müssen. Wir müssen mit dem „social distancing“ noch eine Weile leben lernen und gleichzeitig die Folgen der Pandemie stärker im Blick haben. Das heißt: Die Herausforderungen auch für die psychische Gesundheit ernst nehmen und unser Gesundheitssystem so adaptieren, damit uns dies auch gelingt.
Eine gekürzte Version dieses Blogs erschien in der Wiener Zeitung am 29.12.2020
Abstract
Die Pandemie ist sicherlich noch nicht vorbei und wir werden noch eine Zeit lang physische Kontakte einschränken und mit Social-Distancing leben müssen. Welche Auswirkungen die Pandemie auf unsere psychische Gesundheit hat und vor welchen Herausforderungen unser Gesundheitssystem dadurch steht, darum geht es in der aktuellen Analyse.
%20-%20WEBSITE%20KOPFZEILE.png)


