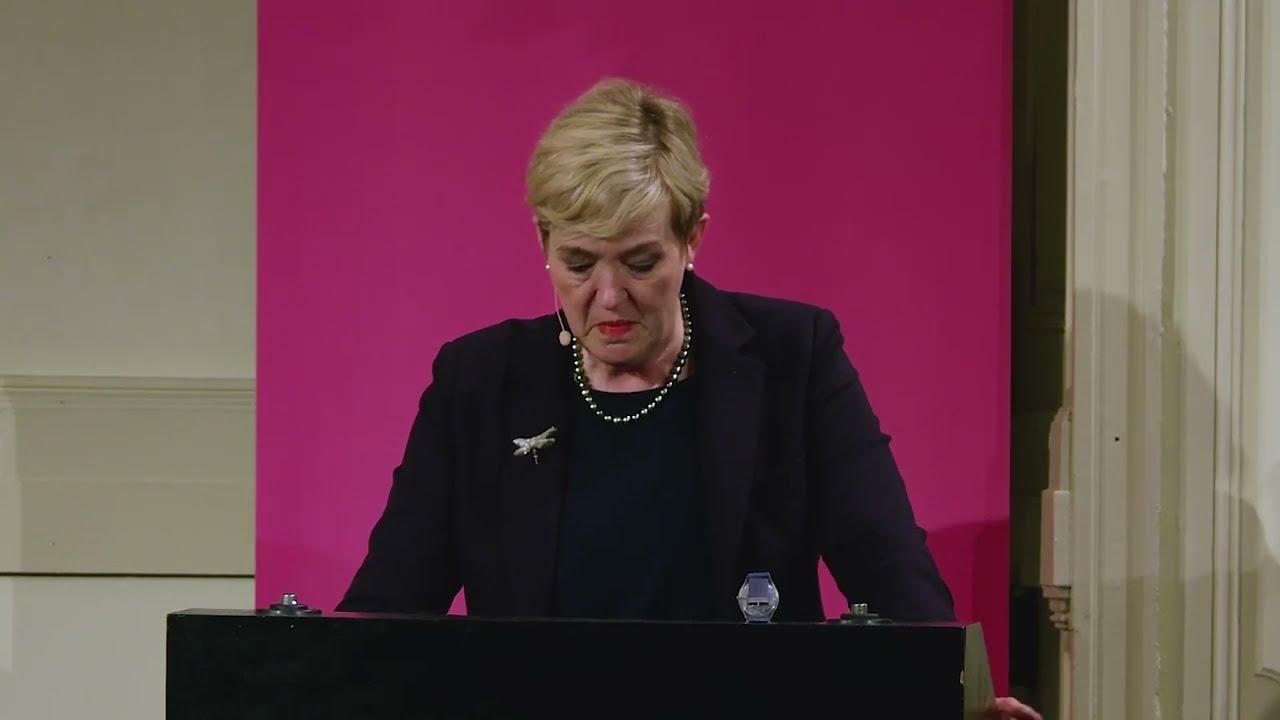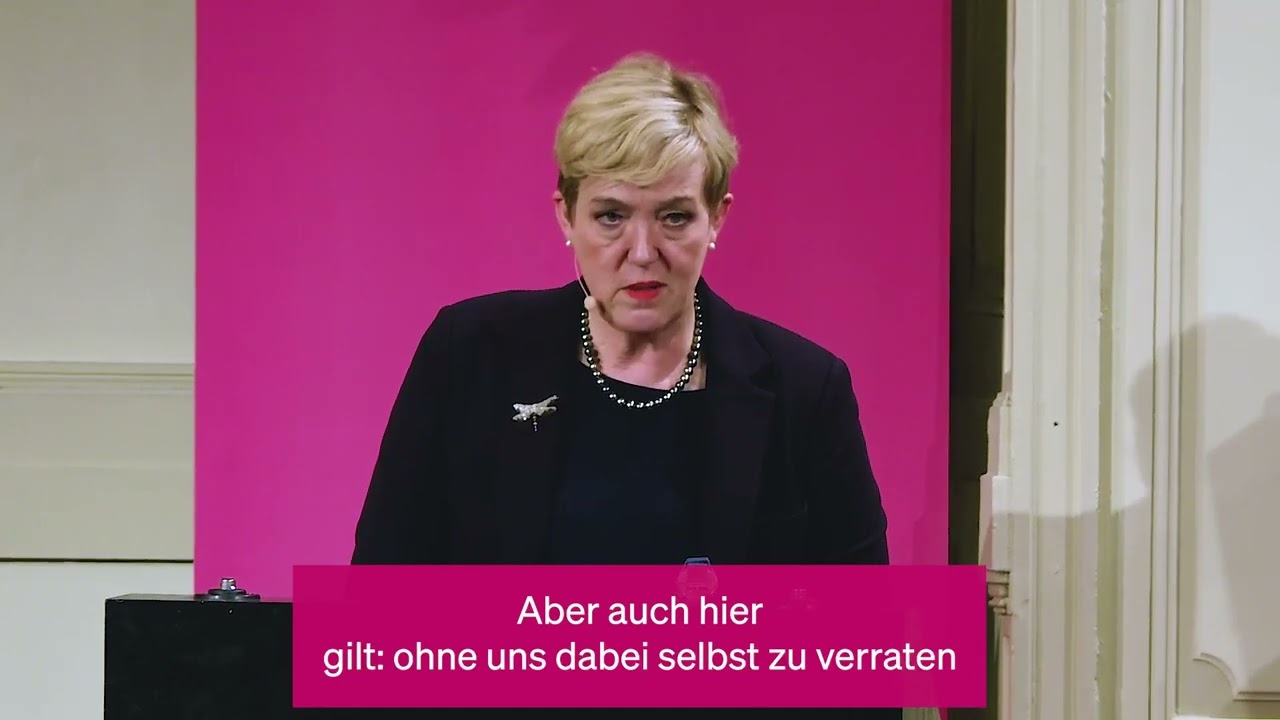„German lessons“ – Constanze Stelzenmüller blickt auf die dreißig Jahre nach dem Mauerfall zurück
Die freie Welt und ihre Feinde
Am 16. Juni 2023 hielt Constanze Stelzenmüller die diesjährige Rede an die Freiheit im Billrothhaus. Die gesamte Rede im Wortlaut.
(Den Nachbericht finden Sie hier. Fotos: Stefan Popovici Sachim.)
-2816x1585-1920x1081.jpg)
Sehr geehrte Damen und Herren,
Ich danke Ihnen aufrichtig für die Einladung, heute vor Ihnen die zweite „Rede an die Freiheit“ zu halten; es ist mir eine wirkliche Ehre. Ich hoffe aber auch, dass es eine Gelegenheit für mich ist, mit Ihnen allen ins Gespräch zu kommen; ich bin neugierig auf Ihre Fragen und Kommentare.
Zugegeben: Nach meiner Zusage vor einigen Monaten hat mich zunehmend das Gefühl beschlichen, ein Irrsinnskommando übernommen zu haben. Der beste Weg für Deutsche, sich hierzulande beliebt zu machen, ist ja bekanntlich, den Österreichern Grundsatzvorträge mit Handlungsempfehlungen zu halten. Wie man in Amerika sagt: What could possibly go wrong?
Andererseits hat einige von Ihnen vielleicht mein Nachname stutzig gemacht. In der Tat sind die pietistischen Vorfahren meines Vaters einst wegen religiöser Renitenz unter Maria Theresia des Innsbrucker Landes verwiesen worden; sie sind dann über die Bayerische Alb nach Deutschland eingesickert, um dort fortan ein Leben in unauffälliger Strebsamkeit zu führen. Ich habe also immerhin einen, wie man heute sagt, österreichischen Migrationshintergrund. Und eventuell hat bei meiner Zusage ja auch die Tatsache mitgespielt, dass meine Mutter, ganz ohne österreichische Vorfahren, eine tiefe Verehrung für den sanft-anarchischen Wahnsinn von Nestroy, die „Merowinger“ von Doderer und vor allem für Qualtinger hegte, die offensichtlich auch bei mir bleibende Spuren hinterlassen hat.
Beate Meinl-Reisinger hat mich gebeten, heute zu Ihnen über „Freiheit und ihre Feinde“ zu sprechen, weil ich an einem Buch mit diesem Titel arbeite. Das ist natürlich eine Anspielung an das Hauptwerk eines weiteren großen Österreichers: Karl Poppers „Die offene Gesellschaft und ihre Feinde“ von 1947. Keine Sorge, ich werde hier keine Exegese von Poppers glühender Antipathie gegen Platon, Hegel und Marx betreiben, oder gar eine Exegese der Exegeten. Ich bin keine Philosophin, sondern mich interessiert, ganz handwerklich, wie Politik besser zu machen ist.
Wenn ich mich dabei vor allem auf deutsche und amerikanische Erfahrungen beziehe, dann deshalb, weil ich diese beiden politischen Kulturen am besten kenne. Aber Sie werden womöglich zum Schluss kommen, dass das eine oder andere – mutatis mutandis – übertragbar ist.
Bei Popper inspiriert mich vielmehr, sehr viel schlichter, die Betonung der politischen Tugenden, die er als Grundlage für das Leben in der liberalen Demokratie identifizierte: das Bekenntnis zu Vernunft und in Empirie begründeter Kritik, und die Ablehnung von Essentialismus, Determinismus und Totalitarismus. Unter Demokratie verstehe ich die Regierungsform, in der das Volk der Souverän ist und sich in regelmäßigen freien und fairen Wahlen für seine Repräsentanten entscheidet. Liberal ist sie dann, wenn die Macht der Regierenden begrenzt wird: durch Gewaltenteilung und -balance, durch politischen Pluralismus, und dadurch, dass die Freiheiten und Rechte der Bürger geschützt sind. Eine liberale internationale Ordnung ist eine, in der die Macht der Nationalstaaten durch Recht und Regeln eingehegt wird: durch Normen, Verträge, Institutionen und Bündnisse.
Das Konzept der „wehrhaften“ oder auch „streitbaren“ Demokratie wurzelt in der Erfahrung, dass die liberale Demokratie auch innere Feinde hat. Nicht von ungefähr basiert es auf der Arbeit von Karl Löwenstein – einem deutschen Juden, der wie Karl Popper ins Exil geflohen war, nachdem die Nationalsozialisten mit dem Ermächtigungsgesetz von 1933 die Weimarer Reichsverfassung außer Kraft gesetzt hatten. Reichspropagandaminister Joseph Goebbels höhnte damals: „Es wird immer einer der besten Witze der Demokratie bleiben, dass sie ihren Todfeinden die Mittel selbst stellte, durch die sie vernichtet wurde.“ (Löwenstein wurde später einer der intellektuellen Väter der Menschenrechtserklärung der Vereinten Nationen.)
-1920x1318.jpg)
Vom Begriff des Feindes wird gleich noch ausführlicher zu reden sein. Aber das Vernichtungsprojekt der Nazis hatte natürlich noch mehr als nur die deutsche Demokratie im Visier: Das nationalsozialistische Deutschland war der ganzen Welt Feind. Der weitere Hergang der Katastrophe ist bekannt.
Das Grundgesetz von 1949 und das Bundesverfassungsgericht zogen aus dieser apokalyptischen Episode der Geschichte die Konsequenz, dass die Institutionen der deutschen Demokratie künftig in die Lage versetzt werden müssten, sich gegen ihre Feinde zu wehren. Der sozialdemokratische Staatsrechtler und Abgeordnete Carlo Schmid, einer der Väter des Grundgesetzes, sagte dazu 1948 in einer berühmt gewordenen Rede im Parlamentarischen Rat: „Ich für meinen Teil bin der Meinung, dass es nicht zum Begriff der Demokratie gehört, dass sie selbst die Voraussetzungen für ihre Beseitigung schafft. […] Man muss auch den Mut zur Intoleranz denen gegenüber aufbringen, die die Demokratie gebrauchen wollen, um sie umzubringen.“
Konkret hieß das unter anderem: Die Kernelemente der Demokratie (z.B. der Grundrechtskatalog und die Staatsstrukturprinzipien) sind unantastbar, sie können durch keine noch so große Mehrheit aufgehoben werden; und Parteien können vom Bundesverfassungsgericht verboten werden, wenn sie nachweislich das Ziel haben, die „freiheitlich demokratische Grundordnung“ zu beseitigen oder zu beeinträchtigen (Art. 21 GG).
Während des Kalten Krieges wurden jedoch nur zwei Parteien verboten: 1952 die NSDAP-Nachfolgeorganisation SRP, und vier Jahre später die kommunistische KPD (ein Verbot der rechtsextremen NPD hat das Bundesverfassungsgericht 2017 abgelehnt). Und wiewohl bei uns viele alte Nazis (und sicher auch ein paar Kommunisten) noch lange in den Institutionen herumspukten, blieben extreme Parteien, linke wie rechte, eher ein Randphänomen der deutschen Politik. Dafür hat die Rote Armee Fraktion, eine linksextremistische Terrororganisation, zwischen 1970 und 1993 mehr als dreißig Menschen ermordet.
Unterdessen war ein großer Teil der Welt in Freundes- und Feindeslager aufgeteilt. Die Grenze zwischen Westeuropa und der Sowjetunion war mit der Berliner Mauer und dem sogenannten Eisernen Vorhang markiert: Hier standen sich die Armeen der US-geführten NATO und der Sowjetunion gegenüber. Das eine war ein Verteidigungsbündnis; die UdSSR dagegen zielte (in den Worten von John Lewis Gaddis) auf die „schließliche Erlangung der sowjetischen Herrschaft über Europa ab“.
Das Wunder des Mauerfalls
Meine Erinnerungen an diese Zeit – this dates me, sagt man in Amerika – sind ziemlich handfest, weil ich in den Achtzigern in Bonn studiert habe, also einem der Schauplätze des Kalten Kriegs. Mit einem Vater im Auswärtigen Dienst und einer größtenteils im Ausland verbrachten Schulzeit habe ich die Bedrohungen der Epoche grundsätzlich ernst genommen – zumal ein Kollege meines Vaters, Gero von Braunmühl, noch 1986 abends vor seinem Bonner Haus erschossen wurde.
Aber ich hatte auch als Schülerin in Washington eine robuste alte Demokratie und im Nach-Franco-Spanien eine blühende neue Demokratie erlebt, und manches in Bonn kam mir ziemlich hypertroph und hysterisch vor: die von Dornenhecken aus NATO-Stacheldraht umkringelten Ministerien, der Radikalenbeschluss und die Rasterfahndung, und, ja, die ständige Rede von der „wehrhaften Demokratie“. Die kommunistische Welt schien damals von entrückten Gerontokraten beherrscht: Breschnew, Andropow, Tschernenko, Jaruzelski, Ceaușescu, Honecker. In Bonn fielen derweil regelmäßig Hunderttausende – 300.000 waren es auf dem Höhepunkt 1982 – von Demonstranten ein, um gegen den NATO-Doppelbeschluss zu protestieren.
Der Grund, warum ich all das schildere: um zu verdeutlichen, wie ergreifend das Wunder des Mauerfalls 1989, der deutschen Vereinigung 1990 und der Selbstauflösung der Sowjetunion damals war. Die USA waren die einzige verbliebene Supermacht, und ihr Hegemonialstatus spiegelte sich in der politischen Theorie: Präsident George H. W. Bush sagte damals vor dem US-Kongress eine „neue Ära“ voraus, „in der die Nationen der Welt, Ost und West, Nord und Süd, blühen und in Harmonie leben können, […] eine Welt, in der die Herrschaft des Rechts die Herrschaft des Dschungels ersetzt, […] in der die Völker die gemeinsame Verantwortung für Freiheit und Gerechtigkeit erkennen […] in der der Starke die Rechte des Schwachen respektiert“. Nach dieser sogenannten Konvergenztheorie würde sich der Rest der Welt unweigerlich – in einer Art von demokratisch-marktwirtschaftlicher Entropie – am siegreichen Westen ausrichten.
Siegeszug der Demokratie
Im nachfolgenden Jahrzehnt gab es tatsächlich so etwas wie einen Siegeszug der Demokratie, der diese schöne Hoffnung zunächst vollauf bestätigte. Die Staaten Osteuropas wählten den Weg der demokratischen Transformation – unter gewaltigen politischen, wirtschaftlichen und sozialen Kosten – und wurden Mitglieder der NATO und der Europäischen Union. Zivilgesellschaftliche Bewegungen stürzten autoritäre Regime in Lateinamerika, Afrika und Asien. Die bipolare Ordnung des Kalten Krieges rekonstituierte sich als im Werden begriffene globale Gemeinschaft. 1998 gab sich die internationale Gemeinschaft – unter dem Eindruck der Genozide in Ruanda und auf dem Balkan – in Rom ein Statut für einen Internationalen Strafgerichtshof, mit Zuständigkeit für Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit (allerdings nicht für den Tatbestand der Aggression).
Es schien wirklich, als sei das Phänomen des Feindes auf der Müllhalde der Historie gelandet. Der amerikanische Historiker Francis Fukuyama postulierte damals nicht nur The End of History, sondern auch, dass die Kategorie des Feindstaats mit einer antiwestlichen Ideologie zum Anachronismus geworden sei: „Das Verschwinden des Marxismus-Leninismus, erst aus China und dann aus der Sowjetunion“, schrieb er, „wird seinen Tod als lebendige Ideologie von welthistorischer Bedeutung zur Folge haben […] und das bedeutet das Schwinden der Wahrscheinlichkeit von zwischenstaatlichen Großkonflikten.“
Das Land, das diese Erzählung vom Ende der Geschichte, dem Sieg des Westens durch Diplomatie und demokratische Transformation und der unwiderstehlichen weltweiten Ausdehnung einer regelbasierten Weltordnung mit der größten Begeisterung übernahm, war das neu vereinigte Deutschland. Der Diplomat Thomas Bagger, damals Leiter des Planungsstabs im Auswärtigen Amt, schrieb 2019 dazu mit sanfter, aber unmissverständlicher Ironie:
„Am Ende eines Jahrhunderts, das davon geprägt war, dass Deutschland zweimal auf der falschen Seite der Geschichte gestanden hatte, fand es sich endlich auf der richtigen Seite wieder. […] Es war eine stabile parlamentarische Demokratie, mit einer erprobten und angesehenen Marktwirtschaft. Während viele andere Ländern rund um den Globus sich würden anpassen müssen, konnte Deutschland so bleiben, wie es war, und darauf warten, dass sich die anderen im Laufe der Zeit an seinem Vorbild orientieren würden.“
Wir waren die Weltmeister der Läuterung, also genossen wir die Friedensdividende in vollen Zügen. Dreißig Jahre nach der Wiedervereinigung würde sich diese bemerkenswert selbstverliebte Deutung des welthistorischen Angelpunkts von 1989 in Berlin als hartnäckige kognitive Blockade bei der Wahrnehmung und Anpassung an eine erneute Klimaverschlechterung in den internationalen Beziehungen und der globalen Sicherheitsordnung erweisen.
Les Trente Glorieuses – die dreißig wunderbaren Jahre – so hat der französische Demografieforscher Jean Fourastié das französische Wirtschaftswunder der Nachkriegszeit genannt. Im Rückblick muss man sagen: Diese Beschreibung gilt noch viel mehr für die Zeit nach 1989. Und das nicht nur für Deutschland, das in diesen Jahrzehnten einen unerhörten Anstieg von Macht, Wohlstand und Ansehen erfuhr, sondern für ganz Europa und den Westen.
Das Ende des Wunders
Seit etwa einem Jahrzehnt allerdings deutet sich an, dass dieses Wunder zu Ende geht. Die globale Finanzkrise (2008/9), aus der bei uns die Eurozonenkrise wurde; die rechtswidrige Annexion der Krim (2014), aus der über acht Jahre hinweg ein Stellvertreterkrieg mit mehr als 10.000 Toten wurde; die Flüchtlingskrise (2015); das Brexit-Referendum (2016); das Aufkommen des rechtsextremen Populismus auf beiden Seiten des Atlantiks, befördert durch die Explosion der sozialen Medien; die Wahl von Donald Trump zum Präsidenten (2017); die dreijährige Pandemie (2020), die nach heutigem Stand sieben Millionen Menschen weltweit das Leben gekostet hat; der Sturm auf das US-Kapitol am 6. Januar 2021; der chaotische Abzug aus Afghanistan im August 2021; und das sich erkennbar von Jahr zu Jahr verschlechternde Erdklima: Alles das hat ein schonungsloses Licht auf die Verwundbarkeiten und Schwächen der westlichen Demokratien wie der internationalen Ordnung geworfen.
In dieser Zeit haben Russland und China begonnen, nicht nur in der eigenen Nachbarschaft, sondern auch auf globaler Ebene und selbst in Europa immer aggressiver aufzutreten. Beide sind inzwischen versiert darin, die alten und neuen Elemente der Globalisierung – von der physischen Infrastruktur wie Gasleitungen und Transportumschlagplätzen bis hin zum digitalen Raum, den Mobilfunknetzen und den sozialen Medien – gegen Europa zu instrumentalisieren, auch durch strategische Aufkäufe und Investitionen; heute nennt man das weaponization of interdependence (ein Begriff des irisch-amerikanischen Ökonoms Henry Farrell).
Moskau ging es dabei erkennbar darum, den Einfluss der USA in Europa zurückzudrängen, die transformative Strahlkraft der EU jenseits ihrer Ostgrenzen abzublocken, und das Verfassungsmodell der freiheitlichen und offenen Demokratie zu entwerten – Letzteres nicht zuletzt durch die Förderung rechtsextremer Parteien und ihrer Vorfeldorganisationen. Pekings Strategie dagegen schien lange vor allem auf wirtschaftliche Expansion fokussiert. Inzwischen wird indes immer deutlicher, dass es China auch um politische Dominanz geht. Genauer: darum, anstelle der USA die globale Vormachtrolle einzunehmen, allerdings zu chinesischen Bedingungen – das heißt, ohne die Garantenfunktion für die Sicherheit Europas oder das Einstehen für die internationale Ordnung.
Anfang Februar vergangenen Jahres versprachen Wladimir Putin und Xi Jinping sich bei der Pekinger Olympiade „grenzenlose Freundschaft“. Knapp drei Wochen später, am 24. Februar 2022, marschierten Putins Truppen in die Ukraine ein. Ein Tag, den man sich nun merken wird wie den 9. November 1989.
Wie sich dann allerdings herausstellte, waren die Abgesänge auf den gelähmten, überforderten und dekadenten Westen verfrüht. Die Ukrainer wehren sich heroisch gegen den Angreifer. Eine US-geführte transatlantische Allianz, der sich aber auch asiatische Staaten wie Japan und Südkorea angeschlossen haben, hat Kyjiw mit Waffen, Geld und humanitärer Hilfe versorgt, und Russland mit einer Staffel von immer schärferen Sanktionen belegt. Die Europäer haben Millionen ukrainischer Flüchtlinge aufgenommen; die EU hat einen militärischen Beschaffungsfonds aufgelegt. Die NATO hat sich erneut der Abschreckung und der Bündnisverteidigung verschrieben; Finnland ist schon Mitglied, Schweden will es werden. Der Ukraine und Moldau ist die EU-Mitgliedschaft versprochen, Deutschland hat Leopard-Panzer in ein Kriegsgebiet geschickt und sich von sämtlichen russischen Energieimporten abgekoppelt (wobei Gazprom uns im September ihrerseits mit dem Abdrehen des Gashahns zuvorgekommen war). Und der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag hat Ermittlungen gegen Putin wegen Kriegsverbrechen aufgenommen. Nichts von alledem wäre vor Februar 2022 als auch nur annähernd als möglich erschienen.
Und trotzdem geht zu Beginn dieses zweiten Kriegssommers in westlichen Hauptstädten Sorge und Angst um. Kann die Ukraine die begonnene Gegenoffensive zum Erfolg führen, und hält die ukrainische Zivilgesellschaft das aus? Russland zeigt keinerlei Bereitschaft zum Einlenken geschweige denn zu Verhandlungen, und will Atomwaffen nach Belarus verlegen … was ist, wenn der Kreml beschließt, noch weiter zu eskalieren, oder die Konfliktzone auszuweiten? Was wird aus der Opferbereitschaft europäischer Bürger, wenn der nächste Winter kalt und das Gas knapp wird? Und warum haben die Populisten wieder Auftrieb – nicht zuletzt die AfD in Deutschland? Warum verharrt die nichtwestliche Welt in einer Mischung aus Abwarten, Schadenfreude und Ablehnung? Wie kann es sein, dass in Amerika Donald Trump wieder der frontrunner der Republikanischen Partei ist? Und was bezweckt Peking mit seinen immer geharnischteren Auftritten – droht hier gar der nächste Krieg, diesmal in Ostasien?
Ausgelagerte Sicherheit
Was hat das alles mit der Freiheit und ihren Feinden zu tun? Wie schon gesagt, ich bin keine Philosophin, deshalb hoffe ich auf Ihre Nachsicht, wenn ich jetzt nicht sonderlich abstrakt werde. Mir scheint, wir haben es uns allesamt in den vergangenen dreißig Jahren in Europa ziemlich einfach und bequem gemacht.
Wir sind – wenn wir ehrlich sind – ebenso fröhliche wie anspruchsvolle Konsumenten von Rechten, Freiheiten und öffentlichen Gütern gewesen, ohne uns allzu viele Gedanken über die materielle und ideelle Grundlage dieser Privilegien zu machen. Wir sind davon ausgegangen, dass unsere demokratischen Verfassungsordnungen selbstreparierend und -legitimierend sind; das Gleiche haben wir von der Balance zwischen Staat, Wirtschaft und Zivilgesellschaft angenommen.
Und dass unsere Geschichte auch eine von erkämpften Freiheiten ist – oder zumindest der Bereitschaft, mit Leib und Leben für sie einzustehen – z.B. 1848 oder 1989, wird in der Erzählung unserer modernen politischen Identität merkwürdig ausgeblendet. Der frühere deutsche Bundespräsident Joachim Gauck hat es zum 70. Jahrestag des blutig niedergeschlagenen Volksaufstands in der jungen DDR am 17. Juni 1953 gesagt: „Wir nehmen unsere eigene Freiheitsgeschichte viel zu wenig wahr.“
Die Erweiterung von EU und NATO hat die Frontstaaten des Kalten Krieges plötzlich mit befreundeten Staaten umgeben – was sie reich, satt und sicher gemacht hat. Dass wir dabei unsere Sicherheitsdilemmata an die Peripherie Europas exportiert haben, ist nur den wenigsten aufgefallen. Gewiss, auch die neuen Mitgliedstaaten haben von der Aufnahme in unsere Clubs profitiert, aber zu unseren (vor allem zu deutschen) Bedingungen.
Wir haben unsere sozialen Sicherungen damit finanziert, dass wir die Verteidigung des Kontinents im wesentlichen an die USA ausgelagert haben, unsere Energiesicherheit an Russland, und unser Handelswachstum an China. Die politischen Entwicklungen dort – die Polarisierung in den USA, den auch nach außen zunehmend aggressiven Autoritarismus in Russland und China haben wir erst verdrängt … und dann sind wir in Schockstarre verfallen. Und ja, es hat nach 1989 einen genuinen globalen Siegeszug der Demokratie und der Verrechtlichung der internationalen Ordnung der Welt gegeben – aber auch hier zu unseren Bedingungen und oft auf Kosten der nichtwestlichen Welt.
-1920x2874.jpg)
„Dass Wokeness und politische Korrektheit die größte Gefahr für die westliche Welt sein sollen: Mit Verlaub, das ist Quatsch. Man muss schon sehr, sehr viel von der Wirklichkeit auszublenden bereit sein, um zu glauben, dass dies das Schlimmste ist, was uns droht.“
Wenn man dagegen einigen deutschsprachigen Massenmedien Glauben schenken darf, leben wir in Europa allesamt in Unfreiheit – unsere Regierungen wollen uns mit Wärmepumpenverordnungen und Tempolimits an die Kette legen, ja, uns sogar das Denken verbieten, und die größte Gefahr für die westliche Welt ist Wokeness und politische Korrektheit. Manche faseln gar von einer „Erziehungsdiktatur“.
Mit Verlaub: Das ist Quatsch. Man muss schon sehr, sehr viel von der Wirklichkeit auszublenden bereit sein, um zu glauben, dass dies das Schlimmste ist, was uns droht.
Die dämonisierten anderen
Die Sicherheitspolitik hat sich bekanntlich in den letzten Jahren seufzend von der Konvergenztheorie verabschiedet und sie durch das Paradigma des „strategischen Wettbewerbs“ (strategic competition) ersetzt. Dieses framing, wie man heute sagt, findet sich heute in allen relevanten Strategiedokumenten: den amerikanischen, denen der EU und auch in der ersten deutschen Sicherheitsstrategie.
Was darin nirgends vorkommt, ist der Begriff des Feindes. In der Tat ist es eine Lehre aus dem Nationalsozialismus gewesen, dass wir im freien Westen fortan unsere eigene nationale Identität nicht mehr gegen den „dämonisierten anderen“ definiert haben. Das war und bleibt eine große zivilisatorische Errungenschaft. Was wir aber wohl nun zur Kenntnis nehmen müssen, ist etwas anderes: dass wir Wettbewerber und Rivalen haben, die uns als ideologische Feinde sehen. In den Worten Carl Schmitts: als absolute Feinde. Oder, etwas altmodischer gesprochen: als Todfeinde. Ob das für Xi Jinpings China gilt, lasse ich hier dahingestellt – wenn auch mit dem Hinweis, dass ich Experten kenne, die das glauben. Ohne jeden Zweifel aber gilt das für Wladimir Putins Russland; und diese Feindschaft gilt nicht nur der Ukraine, sondern Europa, dem Westen und der liberalen Moderne.
Putins häufige Charakterisierung der Kyiwer Führung als „Nazis“, die Tiraden, mit denen Putin über die angeblich korrupte Ukraine und den dekadenten Westen herzieht und droht, „Dreck und Verräter“ in der eigenen Bevölkerung zu „reinigen“, die Drohungen mit einem atomaren Armageddon – diese sprachlichen Topoi sind aus der Geschichte der Völkermorde des 20. Jahrhunderts bekannt.
Mag sein, dass bei Putin eine persönliche Psychopathologie im Spiel ist; genauso ist indes denkbar, dass es sich – wie meine Kollegin Fiona Hill meint – um eine zynische Terrorstrategie handelt, um die Widerstandskraft der Ukraine wie des Westens zu lähmen. Vielleicht ist Putin überzeugt, so gewinnen zu können; vielleicht kann er aber auch nicht mehr anders, weil seine Macht und sein Leben davon abhängen, dass er nicht verliert? Tatsache ist jedenfalls, dass diese enthemmte Sprache täglich von Mitgliedern der Kreml-Führung sowie den Staatsmedien in den grellsten Farben amplifiziert wird; dass sie von einem Großteil der russischen Bevölkerung für bare Münze genommen wird; und dass sie von Putins Streitkräften in auf brutale und sadistische Weise umgesetzt wird. Insofern hat die von Putin öffentlich inszenierte Feindschaft längst ein politisches Eigenleben entwickelt.
Wie also soll der Westen mit diesem Phänomen umgehen? Mindestens folgt aus dem Gesagten, dass die Beweislast für die Aufrichtigkeit von Verhandlungsofferten bei Moskau liegt. (Das Dritte Reich war erst nach einer totalen Niederlage zu Kapitulation und Sühne bereit.) Nur stärkste Garantien – am besten ein klarer, konstruktiver und kurzer Pfad zur EU- und NATO-Mitgliedschaft – können dem Sicherheitsinteresse der Ukraine genügen.
Die NATO, aber auch die Europäische Union, werden ihre Sicherheitsvorsorge radikal neu denken und ihre gewaltigen Defizite überarbeiten müssen. Die Europäer müssen besser (viel besser) darin werden, sich selbst zu verteidigen. Solange Russland intern totalitär und nach außen neoimperial konstituiert ist, kann Europas Sicherheit nur gegen Moskau definiert werden.
Und noch etwas: Wer uns als absoluten Feind denkt, dessen Verhalten müssen, ja dürfen wir nicht spiegeln. Dass dieses Risiko nicht trivial ist, zeigen die Versuche von Beamten des Justizministeriums unter Präsident George W. Bush nach den Angriffen vom 11. September, „verschärfte Verhörtechniken“ wie das waterboarding unter Berufung auf eine quasi unbegrenzte Prärogative der Exekutive zu rechtfertigen. Auch die aktuelle Debatte über den Umgang mit China hat – bei genuin begründeter Sorge – bisweilen hysterische Züge.
Von Friedrich Nietzsche stammt der Satz: „Wer mit Ungeheuern kämpft, mag zusehen, dass er nicht dabei zum Ungeheuer wird. Und wenn du lange in einen Abgrund blickst, blickt der Abgrund auch in dich hinein.“ Das gilt auch in der Sicherheitspolitik.
Innere Feinde
Lassen Sie mich zum Schluss noch etwas über das Phänomen des inneren Feindes sagen – also derjenigen politischen Gruppierungen, die es darauf angelegt haben, freie Demokratien und offene Gesellschaften zu bekämpfen. Systemfeindlichen Linksextremismus gibt es natürlich – aber er scheint mir aktuell ziemlich marginal zu sein. Der systemfeindliche Rechtsextremismus dagegen hat derzeit in Amerika, in Europa und auch bei uns in Deutschland (wo die AfD derzeit 18 bis 19 Prozent in den Umfragen bekommt) in erschreckendem Umfang Konjunktur. Er hat den Diskurs verändert, die eigenen Narrative normalisiert und etablierte konservative Parteien in die Defensive getrieben. Er macht dem Staat zunehmend das öffentliche Gewaltmonopol streitig.
Dass die extreme Rechte vielerorts zudem aus Moskau alimentiert wird, ist inzwischen ebenfalls bekannt. Aber diese Helfershelfer haben die Verwundbarkeiten unserer Demokratien nicht geschaffen – sie nutzen sie allenfalls aus. Und es ist an uns, unsere Freiheiten und Rechte, unsere Demokratie und unsere Verfassungsordnungen nicht nur zu hüten und zu pflegen, sondern sie notfalls auch gegen ihre Feinde zu verteidigen. Aber auch hier gilt: ohne uns dabei selbst zu verraten und die Methoden der Systemverächter zu übernehmen. Wehrhafte Demokratie ist eben nicht nur wehrhaft, sondern auch demokratisch.
Ein emanzipatorischer Akt
Ich weiß, ich habe in dieser Rede ein durchaus dunkles Bild unserer inneren und äußeren Bedrohungen gezeichnet. Aber ich möchte auf einer optimistischen Note enden. Einer meiner Lieblingssätze in der deutschen Literatur stammt aus der Novelle „Die Marquise von O.“ von Heinrich von Kleist (ich zitiere also zum Abschluss doch noch einen Preußen!). Da vollzieht die Hauptfigur, die Marquise des Titels, einen für sie bis dahin unvorstellbaren emanzipatorischen Kraftakt, und Kleist sagt über sie, sie sei „durch diese schöne Anstrengung mit sich selbst bekannt gemacht“.
Das Einstehen für Freiheit und Demokratie – die eigene wie die der Mitmenschen – ist stets ein Kraftakt, und manchmal verlangt er auch von uns, ein Gefühl von Schwäche, Überforderung oder sogar Angst zu überwinden.
Aber er ist eben auch ein emanzipatorischer Akt, ein Moment der Subjektwerdung, also eine schöne Anstrengung: Wir werden darin vom neutralen Konsumenten, vom Objekt der Einflussnahme zum Handelnden, zum Bürger. Das sollten wir begrüßen.
%20-%20WEBSITE%20KOPFZEILE.png)